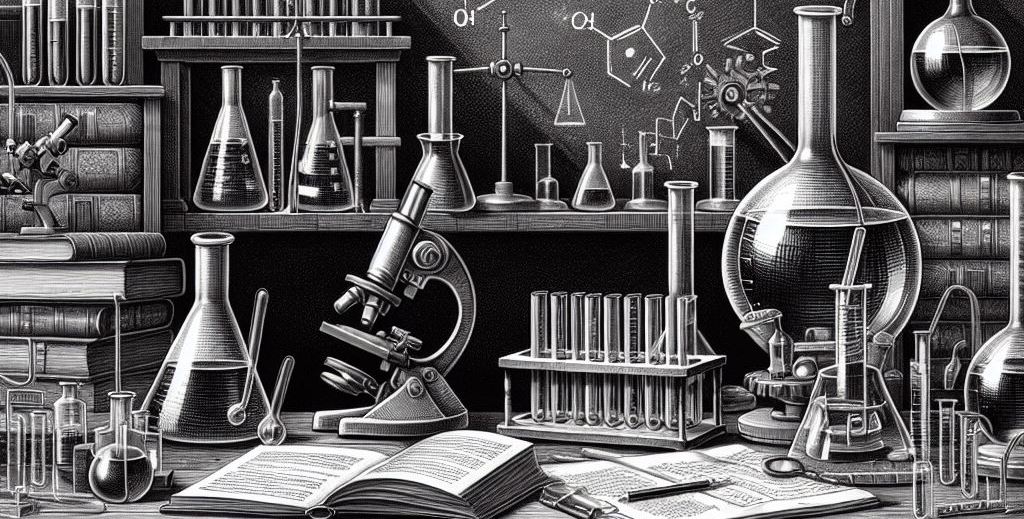Einleitung1
Minimal verbessert am 28.2.2025 und Zitat ergänzt am 20.1.2026
Die Skeptikerbewegung beschäftigt sich mit der Frage nach der Wissenschaftlichkeit verschiedener Aussagesysteme. Paul Kurtz, Philosoph und Gründer des Committee for Skeptical Inquiry (CSI)2, meinte in seinen späten Jahren, dass sich diese Tätigkeit seit der Gründung 1976 verschoben habe. Ursprünglich habe es sich um pseudowissenschaftliche, paranormale Behauptungen gehandelt. Heute kämen jedoch viele der Angriffe auf die Integrität und Unabhängigkeit der Wissenschaft von politisch-theologisch-moralischen Doktrinen.3
2023 gab es Umwälzungen in der deutschen Skeptikerbewegung.4 Zentral war darin ein Streit, ob die postmodern beeinflussten Critical Studies5 aus den Sozialwissenschaften auch ein legitimes Thema sein können.6 Noch 2019 hatte Kendrick Frazier vom CSI die Universalität skeptischer Untersuchungen besonders hervorgehoben.7 Darüber herrschte in der deutschen Skeptikerszene jedoch keine Einigkeit mehr. In der Folge distanzierten sich Mitglieder von der deutschen Skeptikerorganisation GWUP und wollten diesen Ansatz nicht mehr unterstützen.
Einer dieser Kritiker ist der mehrfach ausgezeichnete8 Publizist Florian Aigner, der sich als Physiker und Wissenschaftserklärer9 versteht. Aigner bemängelte vermeintliche ideologische Bestrebungen und stellte diese in einen Zusammenhang mit mangelnder “gesellschaftliche[r] Fairness” und politischer Demagogie.10 Ulrich Berger, der Vorsitzende der Wiener GWUP-Regionalgruppe,11 wies diese Vorwürfe entschieden zurück.12 Mittlerweile, im Januar 2026, hat Florian Aigner seinen kritischen Ton noch einmal verschärft: Die ältere Skeptikerszene sei “völlig ohne Moral” und mittlerweile sogar “gefährlich”.13
Aigner und andere Kritiker fühlen sich wohl immer noch der Wissenschaft verpflichtet. Bisher (Januar 2025) ist jedoch noch kein Grundsatzpapier bekannt, das ihre Position aussagekräftig von der der GWUP abgrenzt. Um dem nachzugehen, bietet es sich daher an, in verwandten Textbeiträgen von Kritikern analytisch nach relevanten Auffassungen, Denkweisen oder Haltungen zu suchen.
Dazu betrachten wir im Folgenden Florian Aigners kurzen Meinungsessay “Die Selbstüberschätzung der Naturwissenschaft”14 aus dem Jahr 2024, der sich mit dem Verhältnis zwischen verschiedenen Wissenschaftsbereichen befasst. Um nichts aus dem Zusammenhang zu reißen, analysieren wir den gesamten Beitrag. Unklarheiten versuchen wir durch einen Blick auf den verwandten, im gleichen Jahr erschienenen Artikel “Aber eine Studie hat gesagt” zu beseitigen.
Inhalt
Eine Frage und ihre unbefriedigende Antwort
Bewertungen
Mathematik - eine Obsession?
Die erste Todsünde
Natur vs. Geist?
Methodenstreit
Reduktionsvorwurf
Mehr Strohmänner
Verhalten und Geschlecht
Empirik als Propaganda?
Paradox der Gleichberechtigung
Sein und Sollen
Motte und Bailey
Fazit
Eine Frage und ihre unbefriedigende Antwort
F. Aigner: “Die Frage, welche Wissenschaftsdisziplinen besser sind als andere, ist sinnlos”
Diesem Motto fehlt es insofern noch an Aussagekraft, als der Komparativ “besser” semantisch unterspezifiziert ist. Wir fragen uns sofort: Besser in welcher Hinsicht? Geht es um wichtigere Untersuchungsgegenstände, zuverlässigere Methoden oder validere Ergebnisse?
- Bedeutung: Für die Menschheit ist die Disziplin der medizinischen Pathologie sicher wichtiger als die Philatelie.
- Methodik: Die evidenzbasierte Medizin bietet mit dem Doppelblindversuch eine erheblich zuverlässigere Methode als das bloße Nachvollziehen eines alten Textes wie dem Organon der “alternativen” Homöopathie.
- Bewährung: Die moderne Hirnforschung liefert deutlich verlässlichere Resultate als die völlig überholte Phrenologie.
D.h. es scheint, dass entgegen dem vorangestellten Motto verschiedene Bereiche, die als Wissenschaft verstanden werden könnten, tatsächlich werden oder wurden, hinsichtlich bestimmter Kriterien doch vergleichbar sind.
F. Aigner: “Was ist wertvoller - Natur- oder Sozialwissenschaft? Leider gibt es immer wieder Leute, die die Disziplinen gegeneinander ausspielen.”
Nun schränkt Florian Aigner seine Frage auf einen Vergleich zwischen Natur- und Sozialwissenschaften ein. Aber auch der neue Komparativ “wertvoller” ist erläuterungsbedürftig: Wertvoll für wen oder wertvoll in welcher Hinsicht?
F. Aigner: “In Italien gibt es Pizza, in Japan bekommt man Sushi. Was ist besser? Das ist eine dumme Frage. Beides hat seine Berechtigung, aus persönlichen Vorlieben kann man kein klares Werturteil ableiten. So ähnlich ist es in der Wissenschaft. Ich persönlich bin Physiker und finde Naturwissenschaften besonders spannend. Aber auch Geistes- und Sozialwissenschaften liefern ständig wichtige Erkenntnisse, die unseren Horizont erweitern und unser Leben verbessern.”
Die darauf folgende Einlassung des Autors überrascht, in der er von einer objektiven zu einer rein subjektiven Betrachtungsweise übergeht, nämlich dem personenabhängig variierenden Interesse an einem Themenbereich. Mehr als Vorlieben soll es hier anscheinend nicht zu entdecken geben. Dass unterschiedliche persönliche Präferenzen existieren, dürfte zwar kaum strittig sein. Es erscheint aber höchst fraglich, ob z.B. ein Vergleich zwischen einer Hirnforschung, die naturwissenschaftliche Errungenschaften anwendet, und einer stark auf Analogieschlüssen beruhenden Phrenologie15 wirklich nur einer subjektiven Geschmacksentscheidung wie diejenige zwischen Pizza und Sushi entspricht. Der Vergleich ist zudem etwas unglücklich, da nicht auszuschließen ist, dass Sushi ernährungsphysiologisch objektivierbar besser abschneidet als Pizza. Schließlich erweitert Florian Aigner nun seine Betrachtungsgegenstände noch um die Geisteswissenschaften.16
Bewertungen
F. Aigner: “Ich beobachte allerdings immer wieder, dass manche Leute aus den Naturwissenschaften eine Grenze zu ziehen versuchen, zwischen ‘wertvollen, harten Wissenschaften’ und ‘minderwertigen, weichen Wissenschaften’.”
Es kommt durchaus vor, dass in Gesprächen oder in den Medien sehr schlicht zwischen “wertvollen, harten Wissenschaften” und “minderwertigen, weichen Wissenschaften” unterschieden wird. Das ist aber keine These “der Naturwissenschaft” [Herv. d. Verf.], wie der Titel “Die Selbstüberschätzung der Naturwissenschaft” suggeriert. Schließlich ist auch erst auf der Metaebene der Wissenschaftstheorie oder Philosophie ein Vergleich zwischen verschiedenen Wissenschaftsfächern möglich. Die Gegensatzpaare weich und hart bzw. wertvoll und minderwertig charakterisieren derartige Kritik jedoch zumindest unzureichend. So erkennt beispielsweise der Philosoph Mario Bunge in “Social Science under Debate” den Fortschritt der Sozialwissenschaften an und möchte nicht den Eindruck erwecken, dass sie nur mit Problemen zu kämpfen habe. Er warnt aber vor falschen Philosophien oder ideologischen Dogmen.17
F. Aigner: “Auf der einen Seite werden Atomphysik und Molekularbiologie eingeordnet, auf der anderen Seite Soziologie oder Pädagogik. Und wehe jemand sagt ‘Gender Studies’, dann ist die Diskussion überhaupt vorbei. […] Das ist natürlich eine kindische und irrationale Sichtweise. Es erinnert an 5-Jährige, die streiten, ob Spider-Man nun stärker ist als Optimus Prime.”
Dass die Untersuchungsgegenstände der Pädagogik und der Soziologie inklusive ihres Teilgebiets der Gender Studies relevant sind, wird ernsthaft kaum bestritten. Wesentliche Arbeiten aus den Gender Studies stehen aber tatsächlich in der Kritik etwa hinsichtlich ideologischer Prämissen, kritikimmunisierender Theoriebildung oder kontrafaktischer Ergebnisse. Der aignersche Text erweckt hier gewollt oder ungewollt den Eindruck, dass diese Kritik zum einen irrelevant ist und zum anderen nur aus dem naturwissenschaftlichen Bereich kommt. Letzteres ist aber nicht der Fall, denn es gibt auch viel Kritik aus den Geisteswissenschaften18.
Schließlich vergisst Aigner zu erwähnen, dass umgekehrt auch die Soziologie die Naturwissenschaften kritisierte. Bekannt ist die in den 70iger Jahren in Schottland und Frankreich entstandene Wissenschaftssoziologie des sog. “strong programme”. Das Attribut “strong” bezieht sich auf die Tatsache, dass auch Theorien, die sich allgemein empirisch bewährt haben, lediglich anhand von sozialen Kriterien erklärt werden sollen, was einem starken Sozialkonstruktivismus entspricht.
Da die Geisteswissenschaft der Philosophie von einer Metaebene aus arbeitet, kommt aus diesem Bereich auch (durchaus harsche) Kritik an den Naturwissenschaften. Bekannt sind z.B. die Einlassungen des Philosophen Paul Feyerabend, der Naturgesetzaussagen mit Mythen verglich. Ausgehend von umstrittenen Interpretationen der Naturphilosophie Francis Bacons bringt die Philosophin Sandra Harding naturwissenschaftliches Experimentieren sogar mit Vergewaltigung und Folter in Verbindung.19
In jüngerer Zeit dringt eine aktivistische Ideologie, die sich in den Sozialwissenschaften entwickelt20 hat, sogar direkt in die Naturwissenschaften ein. Das betrifft ganz besonders aber nicht nur die Evolutionsbiologie.21
Mathematik - eine Obsession?
F. Aigner: “Mathematik-Obsession: […] Kürzlich hörte ich einen Physiker, der versuchte, in einer solchen Diskussion die Psychologie zu verteidigen. ‘Das ist durchaus eine ordentliche Wissenschaft’, meinte er, ‘denn da kommt viel Statistik vor.’ Das ist ein merkwürdiges Argument. Warum soll das Maß an Statistik (oder Mathematik im Allgemeinen) ein Indikator für den Wert einer Wissenschaftsdisziplin sein? Aber vielleicht ist das ein Indiz für die Ursache naturwissenschaftlicher Selbstüberschätzung: In einem sozialwissenschaftlichen Studium kommt meist eher wenig Mathematik vor, oft steht aber eine Statistik-Vorlesung auf dem Lehrplan, in der es darum geht, wie man empirische Daten ordentlich auswertet. Besonders beliebt sind diese Vorlesungen selten, oft gelten sie als ärgerliche Hürden im Studium.”
Dass solide Empirie in den Sozialwissenschaften tendenziell - so Florian Aigner - als ärgerliche Hürde wahrgenommen wird, erscheint bedenklich. Schließlich sollen Sozialwissenschaften keine Domäne der reinen Phantasie sein, sondern vielmehr möglichst zutreffende Erkenntnisse über soziale Realitäten liefern. Wenn aus sozialwissenschaftlichen Hypothesen oder Theorien nichts folgt, was in der Realität der Fall sein muss oder nicht der Fall sein darf, sind sie empirisch gehaltlos. Wenn daraus abgeleitete Aussagen sogar kontrafaktisch sind, ist der Theorieansatz falsch. Eine Wissenschaft, die sich mit Realitäten befasst, muss die Empirie einbeziehen und kann nicht nur eine “Lehnstuhlwissenschaft” sein.
Der Streit um die Methoden in der Sozialwissenschaft ist schließlich auch ein innerdisziplinärer, der mehr als 60 Jahre alt ist. Bekannt ist der Methodenstreit zwischen dem Dialektiker Adorno aus der “Frankfurter Schule” und dem Empiriker Silbermann der “Kölner Schule” der Soziologie. Die “Kritische Theorie” Adornos hat die Disziplinen der so genannten “Critical Studies” inspiriert, um die heute erneut gerungen wird.
Mathematik ist keine Naturwissenschaft, denn die Mathematik sagt selbst nichts über die Natur aus. Mathematik ist rein abstrakt und nicht zuletzt ist auch die Logik Teil der Mathematik. Ein Wissenschaftsbereich, der die formale Logik ablehnt, erregt zurecht den Verdacht, dass bei ihm etwas nicht stimmt. Die Logik steht auch fest im Lehrplan der Philosophie. So benutzt z.B. das modelltheoretische Argument des Philosophen Hilary Putnam22 sogar avancierte mathematische Theoreme. Bei Putnams Argument geht es nicht etwa um Naturwissenschaft, sondern um die Interpretation sprachlicher Symbole also ums geisteswissenschaftliche Verstehen. Der Philosoph Mario Bunge verwendet in seiner achtbändigen “Treatise on Basic Philosophy”23 eine ganze Reihe mathematischer Konzepte, wie Menge, Funktion, Verband, boolesche Algebra, Filter, topologischer und metrischer Raum. Damit steht die Mathematik auch einem Teil der Geisteswissenschaften nahe, deren Verteidigung Florian Aigner offensichtlich ebenfalls am Herzen liegt.
Für Florian Aigner scheint die Nähe zur Mathematik ein Indiz für die Ursache naturwissenschaftlicher Selbstüberschätzung zu sein, wobei er diese Selbstüberschätzung einfach voraussetzt. Die Intensität der Mathematisierung ist in den einzelnen naturwissenschaftlichen Disziplinen Physik, Chemie, Biologie oder Geowissenschaften allerdings unterschiedlich ausgeprägt. Es ist fraglich, ob es in der Zoologie mehr Mathematik gibt als in der empirischen Psychologie. Überschätzt sich die Psychologie daher auch? Am meisten müsste sich aber die Mathematik überschätzen, denn sie steht sich sicher am nächsten.
Die erste Todsünde
F. Aigner: “Leute aus der Naturwissenschaft hingegen sind den Umgang mit Mathematik gewohnt, ihnen erscheinen diese gefürchteten Statistik-Vorlesungen vielleicht als relativ einfach. Und daraus wird dann geschlossen: ‘Wenn das, was in diesem Studium als schwierig gilt, für mich einfach ist, dann bin ich diesen Leuten überlegen. Somit bin ich in Sozialwissenschaften besser als die gelernten Sozialwissenschaftler.’”
Diese Passage über unangemessene Überlegenheitsgefühle weckt Assoziationen mit der ersten “himmelschreienden”24 Todsünde, dem Hochmut. Das im Text gezeichnete Bild einer naturwissenschaftlichen Hybris scheint jedoch einseitig. Das Gegenteil, nämlich eine behauptete generelle Überlegenheit der Geisteswissenschaften, lässt sich nämlich auch leicht belegen. Dietrich Schwanitz’ erfolgreiches und mehrfach nachgedrucktes25 Buch “Bildung - Alles was man wissen muss” enthält folgende26 Passage:
Schwanitz: “Die naturwissenschaftlichen Kenntnisse werden zwar in der Schule gelehrt; sie tragen auch einiges zum Verständnis der Natur, aber wenig zum Verständnis der Kultur bei. Deshalb gilt man nach wie vor als unmöglich, wenn man nicht weiß, wer Rembrandt war. Wenn man aber keinen Schimmer hat, worum es im zweiten thermodynamischen Hauptsatz geht oder wie es um das Verhältnis der schwachen und starken Wechselwirkung des Elektromagnetismus und der Schwerkraft bestellt ist, oder was ein Quark ist, obwohl die Bezeichnung aus einem Roman von Joyce stammt, dann wird niemand daraus auf mangelnde Bildung schließen. So bedauerlich es manchem erscheinen mag: Naturwissenschaftliche Kenntnisse müssen zwar nicht versteckt werden, aber zur Bildung gehören sie nicht.”
Das ist konsequent am Ideal der klassisch humanistischen Bildung orientiert, die den Schwerpunkt auf geisteswissenschaftliche Fächer wie alte Sprachen, Literatur, Philosophie, Geschichte und Kunst legt. Naturwissenschaften kommen nicht vor. Das Kapitel, in dem der obige Textauszug steht, trägt bezeichnenderweise auch den Titel “Was man nicht wissen sollte”. Traditionell existiert also das Gegenteil dessen, was Florian Aigner diagnostiziert und kritisiert, nämlich eine vermeintliche Überlegenheit des geisteswissenschaftlichen Arbeitens.
Natur vs. Geist?
Manche Fragen, die früher eine Domäne der Philosophie waren, sind heute aber auch Themen der Naturwissenschaften:
- Woher die Welt kommt, fragt auch die Kosmologie, wenn sie die Verhältnisse kurz nach dem Urknall studiert.
- Woher wir kommen, untersucht auch die Evolutionsbiologie, wenn sie versucht, die Prozesse aufzuklären, die zur Entstehung der Spezies Homo sapiens geführt haben.
- Woher das Bewusstsein kommt, erforscht auch die moderne Neurologie, wenn sie nach den Ursachen des Bewusstseins sucht.
- Auch zu der Frage, wohin wir gehen, kann die Naturwissenschaft einen plausiblen Beitrag leisten, wenn sie darauf hinweist, dass das Leben auf der Erde wohl ausstirbt, wenn sich die Sonne in einigen Mrd. Jahren zu einem Roten Riesen aufbläht.
Die Ergebnisse naturwissenschaftlicher Untersuchungen können dabei geisteswissenschaftlichen Thesen widersprechen.
- Dualismus von Geist und Körper: Diese Annahme erscheint zunehmend unplausibel, da die Erkenntnisse der Neurowissenschaften zeigen, dass mentale Vorgänge ohne physische Gehirnaktivitäten nicht möglich zu sein scheinen.
- Radikaler Sozialkonstruktivismus: Dass das Fortpflanzungsgeschlecht der Spezies Homo sapiens ein soziales Konstrukt sei, wie es Judith Butler poststrukturalistisch inspiriert nahelegt, widerspricht der Evolutionstheorie. Schließlich hat sich diese zweigeschlechtliche anisogame Fortpflanzung im Laufe der Evolution immer wieder herausgebildet, ohne dass man dabei in irgendeiner Weise plausibel von einer sozialen Konstruktion, d.h. von sozialen und kulturellen Praktiken ausgehen könnte. Das Fortpflanzungsgeschlecht der Mammalia ist kein soziales Konstrukt27, sondern ein evolutionär entstandener Überlebensmechanismus. Wenn die Fortpflanzung endet, stirbt eine Spezies schlicht aus, dagegen hilft auch kein Konstruktivismus.
- Radikaler Sprachkonstruktivismus: Ein neueres Lehrbuch über soziale Gerechtigkeit behauptet, dass Sprache die Realität konstruiert.28 Das ist angesichts der Tatsache, dass bestimmte Experimente immer konsistente Ergebnisse haben, äußerst unplausibel. Die Aussagen der Wissenschaft konstruieren (d.h. erschaffen) die Realität nicht, sondern versuchen sie sprachlich zu rekonstruieren, wobei Irrtümer möglich sind. Konstruieren lassen sich nur Konstrukte, d.h. Fiktionen, aber nicht die Realität. Mit anderen Worten: Wir konstruieren ein Modell der Realität, nicht die Realität selbst. Real sind nur Individuen, die an bestimmte Fiktionen glauben.
Die Natur- und die Geisteswissenschaften stehen nicht völlig unverbunden nebeneinander. Geisteswissenschaftliche Methoden wie die linguistische Begriffsanalyse oder das logisch konsequente Durchdenken von Prämissen haben auch in den Naturwissenschaften Bedeutung. Wenn geisteswissenschaftliche Aussagen von der Welt handeln, dürfen sie ihrerseits nicht empirisch leer sein. Dogmatik ist aber nirgends Wissenschaft.
Methodenstreit
F. Aigner: “Das ist natürlich ein logischer Fehlschluss. Wenn man gute Sozialwissenschaft produzieren will, kommt es nicht darauf an, möglichst regelkonforme Statistik anzuwenden (auch wenn das natürlich wichtig ist). Es geht zunächst darum, ein Problem, das auf hochkomplizierte Weise mit anderen Fragestellungen zusammenhängt, präzise zu definieren. Es geht darum, überhaupt mal die passenden Methoden herauszufinden, um das Problem zu analysieren. Es geht darum, die bestehende Literatur zu kennen, die eigene Arbeit in das bestehende Theoriegebäude einzufügen und versteckte Zusammenhänge zu erkennen.” [Hervorhebungen im Original]
Florian Aigner nennt hier drei Aspekte des wissenschaftlichen Arbeitens. Diese sind aber keineswegs auf die Sozialwissenschaften beschränkt, sondern von genereller Relevanz:
- Der Untersuchungsgegenstand muss immer erst analysiert werden. In der Erfahrungswelt kann es auch nichts völlig Isoliertes geben, denn ohne Wechselwirkungen lässt sich ein Gegenstand in der äußeren Welt überhaupt nicht untersuchen.
- Welche Untersuchungsmethode geeignet ist, muss auch immer betrachtet werden.
- Die Kenntnis der Literatur und der bestehenden Theorien ist im Allgemeinen ebenfalls unverzichtbar. In der Regel fügt sich die eigene Arbeit entweder in das bestehende Theoriegebäude ein oder sie verändert es, weil sie ihm widerspricht.
- Natürlich versuchen auch die Naturwissenschaften verborgene Zusammenhänge aufzudecken, aber das hat direkt nichts mit Literatur zu tun.
Die Bedeutung der von Aigner genannten allgemeinen Aspekte ist unstrittig. Strittig ist hingegen,
- ob Dogmen einfach so Gültigkeit zukommen,
- ob eine Analyse anekdotischer Berichte mehr als Hypothesengenerierung sein kann,
- ob Moralismus als Wahrmacher deskriptiver Aussagen zulässig ist,
- ob Sozialkonstruktion biologisch physische Gegebenheiten eliminieren kann
- oder ob rhetorische Dialektik als valider Beleg zählt.
Kritische Betrachtungen einiger Ergebnisse der Sozialwissenschaften drehen sich u.a. um die oben genannten Punkte. Der Elefant im Raum, den Florian Aigner hier ausspart, ist die empirische Evidenz. Auch in den Sozialwissenschaften muss es schließlich darum gehen, das Häufige vom Seltenen und das Notwendige vom Kontingenten zu unterscheiden. Dazu gibt es auch einen innerwissenschaftlichen Diskurs.
Reduktionsvorwurf
F. Aigner: “Naturwissenschaftliche Diskussions-Verkürzung […] Wenn man stattdessen einfach eine mathematische Formel auf den Tisch knallt, wird man der Komplexität der Welt nicht gerecht. Aber es fühlt sich unglaublich seriös an – Mathematik lügt schließlich nicht.”
Diese Haltung ist auch naturwissenschaftlich inadäquat, denn abstrakt mathematische Aussagen haben keine realen Referenzgegenstände.29 Reine Mathematik “lügt” nicht über die Realität, sie schweigt. Erst die faktisch interpretierte Mathematik kann Bezug zur Realität haben. Erhärten lassen sich solche Aussagen aber nur durch empirische Prüfung. Ob die Mathematik der Stringtheorie etwas über die physikalische Realität aussagen kann, ist z.B. noch ungewiss, da es dafür bislang noch keine Evidenz gibt.30 Einfach nur Formeln auf Tische zu knallen, ist im Übrigen überhaupt nirgends Wissenschaft. Formalismen dienen allerdings der Klarheit, indem sie begriffliche Präzision und Modellbildung fördern. Klarheit ist ein Qualitätsmerkmal von Wissenschaft.
Mehr Strohmänner
F. Aigner: “Oder man kramt eine simple naturwissenschaftliche Tatsache hervor, die mit einer sozialwissenschaftlichen Frage zu tun hat, und behauptet dann einfach, diese Frage damit beantwortet zu haben. Es geht um Transsexualität im Sport? Man spricht einfach über Chromosomen und hält die Sache für erledigt. Es geht um die soziale Akzeptanz der Kernenergie? Man spricht über die überlegene Energiedichte von Uran und erklärt sich zum Sieger. Es geht um den Wandel von Geschlechterrollen? Man erklärt Geschlechterrollen mit wackeligen Evolutions-Argumenten für natürlich und angeboren, und muss sich keine weiteren Gedanken mehr machen.” [Hervorhebungen im Original]
In dieser Passage stecken Strohmann-Argumente.
- Es ist nicht zutreffend, dass sich die Diskussion um die biologischen Aspekte von “Transsexualität im Sport” auf einen einfachen Verweis auf Chromosomen beschränkt. Zwar ist ein XY-Chromosomenpaar ein sehr starker Hinweis auf ein männliches Individuum, im Diskurs wird aber insbesondere die Wirkung von Hormonen auf die körperliche Leistungsfähigkeit betrachtet.31 Das ist auch Gegenstand empirischer Untersuchungen.32
- Es ist zwar richtig, dass aus der Energiedichte von Uran nichts für die “soziale Akzeptanz der Kernenergie” folgt. Aber wer behauptet wirklich das Gegenteil?
- Was mit dem “Wandel von Geschlechterrollen” genau gemeint ist und worin der Bezug zur Evolution des Homo sapiens besteht, wird nicht ganz klar. Der nachgeschobene Vorwurf der Reflexionsverweigerung erscheint sehr pauschal, was auf ein Strohmann-Argument hinweist.
Im folgenden beschäftigen wir uns ein wenig näher mit Florian Aigners drittem Einwand.
Verhalten und Geschlecht
Begriff der Geschlechterrolle
Der Begriff “Geschlecht” lässt sich heute eigentlich nicht mehr ohne vorherige Erläuterung verwenden, denn ihm werden radikal unterschiedliche Bedeutungen hinterlegt:
- Die Biologie der Mammalia definiert das “Geschlecht” eines Individuums über seine Fortpflanzungsfunktion: Der Körper eines Mammalia-Organismus ist entweder auf die Produktion von Eizellen oder von Spermien ausgerichtet. Eine dritte Kategorie von Gameten ist unbekannt, die Fortpflanzungsfunktion ist bei den Mammalia auch nicht änderbar.
- In identitär geneigten Sozialwissenschaften kann mit “Geschlecht” nicht mehr als ein beliebiger Sprechakt gemeint sein. Bei diesem Begriffsverständnis braucht kein Zusammenhang mit der Fortpflanzungsfunktion zu bestehen. Die Zahl dieser Geschlechter ist daher nur durch die menschliche Phantasie begrenzt. Abgesehen vom Vorhandensein eines Sprechaktes ist diese Begriffsbedeutung semantisch leer.
Unterstellt man den zweiten, weitgehend leeren Geschlechtsbegriff, so handelt es sich bei Geschlechterrollen nur noch um irgendwelche Rollen, denn eine begrifflich leere Zeichenfolge leistet keinen zusätzlichen Beitrag zum Begriffsinhalt. Im Folgenden sei daher hypothetisch der fortpflanzungsbiologische Geschlechtsbegriff unterstellt.
In der Biophilosophie gibt es den Begriff der Rolle eines Organismus als “externe Aktivität”33, also als etwas, das ein Organismus nach außen hin tut. Für den allgemeinen Sprachgebrauch können große KI-Sprachmodelle Anhaltspunkte liefern. Danach umfasst ein gängiges Verständnis des Begriffs Geschlechterrolle tatsächliche oder sozial erwartete (d.h. normative34) Verhaltensweisen, die sich je nach Geschlecht nennenswert unterscheiden.35
Es bleibt nun zu klären, welchen Wandel der Geschlechterrollen und welche wackeligen Evolutionsargumente Florian Aigner nun genau im Sinn gehabt haben könnte.
Gedankenlose Disziplin?
Um welche wissenschaftliche Disziplin könnte es sich handeln, die sich nach Aigner durch einen unreflektierten Umgang mit “wackeligen Evolutions-Argumenten” auszeichnet? Geht es vielleicht um die evolutionäre Psychologie?36 Sie geht davon aus, dass sich mentale Mechanismen im Laufe der Evolution des Gehirns als Anpassung an Umweltbedingungen entwickelt haben. Die evolutionäre Psychologie fragt weiter, wie die so entstandene menschliche Denkfähigkeit zu beobachtbarem Verhalten in modernen sozialen Umgebungen führt. In der Disziplin existiert ein weit entwickelter innerwissenschaftlicher Diskurs.37
Ein konkurrierender Ansatz besteht darin, dass das Gehirn bei der Geburt eine Tabula rasa (“blank slate”)38 ist. Unterschiede entstünden praktisch ausschließlich durch soziale Prozesse, angeborene Neigungen könnten, falls sie überhaupt bestehen, zumindest vernachlässigt werden. In der Philosophie und auch in den Religionen gibt es auch die Vorstellung einer geistigen Entität, die vom Körper unabhängig ist und für die Gilbert Ryle vor ca. 75 Jahren den Begriff “ghost in the machine”39 prägte.
Empirische Untersuchungen
Welche Ergebnisse über die Beziehungen zwischen Verhalten und Evolution finden sich in der wissenschaftlichen Literatur denn tatsächlich?
- Sozialisationsprozesse gelten als die Hauptursache für geschlechtsspezifische Unterschiede bei der Spielzeugpräferenz. Alternativ könnten Spielzeugpräferenzen aber auch biologisch bedingte Vorlieben für bestimmte Aktivitäten widerspiegeln. Hasset et al.40 beschäftigen sich mit dieser Frage, indem sie das Verhalten von Rhesusaffen experimentell untersuchen. Sie fanden geschlechtsspezifisches Verhalten, das dem von Menschenkindern deutlich ähnelt, ohne dass die Affen eine vergleichbare Sozialisierung erfahren hätten.
- Experimente an Labortieren zeigen, dass in den Hoden produzierte Hormone zu geschlechtsspezifischen Verhaltensunterschieden beitragen. Solche Versuche am Menschen wären jedoch unethisch. Shirazi et al.41 haben daher das erinnerte geschlechtsspezifische Rollenverhalten in der Kindheit bei Personen mit typischer Entwicklung und bei Personen mit isoliertem Gonadotropin-Releasing-Hormon-Mangel (IGD)42 gemessen. Die Ergebnisse der Studie deuten darauf hin, dass eine niedrige Exposition gegenüber Gonadotropin-Releasing-Hormonen während der mittleren bis späten Schwangerschaft und der frühen Kindheit bei Männern eine höhere erinnerte Geschlechtsinkongruenz in der Kindheit vorhersagt. Dies deutet darauf hin, dass die Androgenwirkung eine nicht zu vernachlässigende Bedeutung für die Entwicklung des männlichen Spiel- und Geschlechtsrollenverhaltens hat.
- Präferenzen können das menschliche Verhalten prägen und zu unterschiedlichen wirtschaftlichen und sozialen Ergebnissen zwischen Frauen und Männern beitragen. Falk und Hermle43 präsentieren eine globale Untersuchung der geschlechtsspezifischen Unterschiede bei sechs grundlegenden Präferenzen. Die Daten bestehen aus Umfrageergebnissen über Risikobereitschaft, Geduld, Altruismus, positiver und negativer Reziprozität und Vertrauen von 80.000 Personen in 76 repräsentativen Länderstichproben. Geschlechtsspezifische Unterschiede in den Präferenzen standen in einem positiven Zusammenhang mit der wirtschaftlichen Entwicklung und der Gleichberechtigung der Geschlechter. Dieses Ergebnis deutet darauf hin, dass eine größere Verfügbarkeit von und ein gleichberechtigter Zugang zu materiellen und sozialen Ressourcen die Ausprägung geschlechtsspezifischer Präferenzen in verschiedenen Ländern begünstigt.
- Zahlreiche Studien haben die Partnerpräferenzen von Menschen in verschiedenen Kulturen untersucht. Dabei stellten sich universelle geschlechtsspezifische Unterschiede in den Attraktivitäts- und Ressourcenpräferenzen heraus. Systematische kulturelle Unterschiede wurden ebenfalls untersucht. Als konkurrierende Erklärungsansätze für die Ergebnisse wurden evolutionspsychologische und sozialkonstruktivistische Ansätze vorgeschlagen. Walter et al.44 haben mit einer neuen Stichprobe aus 45 Ländern versucht, klassische Studien zu replizieren und sowohl die evolutionäre als auch die sozialkonstruktivistische Erklärung zu testen. Die Unterstützung für universelle Geschlechtsunterschiede bei den Präferenzen blieb robust: Männer bevorzugen attraktive, junge Partner mehr als Frauen das tun, und Frauen bevorzugen ältere Partner mit günstigen finanziellen Aussichten mehr als Männer. Interkulturell betrachtet bevorzugen beide Geschlechter mit zunehmender Gleichberechtigung Partner, die ihrem eigenen Alter ähnlicher sind. Abgesehen vom Alter des Partners konnte der Grad der Geschlechtergleichberechtigung die geschlechtsspezifischen Unterschiede oder Präferenzen in den verschiedenen Ländern aber nicht zuverlässig vorhersagen.
- In einer neuen Studie von Ryali et al.45 zeigten sich bemerkenswerte Unterschiede zwischen weiblichen und männlichen Gehirnen. Die Forscher verwendeten ein tiefes neuronales Netzwerkmodell, um latente funktionelle Hirndynamiken aufzudecken, die männliche und weibliche Gehirne unterscheiden. Die geschlechtsspezifischen Unterschiede in der funktionellen Hirndynamik erwiesen sich als in hohem Maße reproduzierbar. Es gab keine Überlappungen zwischen Männern und Frauen, was die Vorstellung eines Kontinuums unplausibel macht.
Die von Florian Aigner postulierte Gedankenlosigkeit scheint in der Fachliteratur doch nicht allgegenwärtig zu sein, wenn es um die Frage angeboren oder sozial konstruiert geht. Die Problemstellung wird empirisch mit sehr unterschiedlichen Ansätzen untersucht. Dass es soziale Konstruktion gibt, wird nicht bestritten, dass evolutionäre Einflüsse einfach vernachlässigt werden können, erscheint angesichts der Befunde aber höchst unplausibel.
Empirik als Propaganda?
Um die Intention der aignerschen Anmerkung über Geschlechterrollen besser zu erschließen, hilft vielleicht auch ein Blick in den Artikel “Aber eine Studie hat gesagt” des Autors, der ein halbes Jahr zuvor publiziert wurde. Dort46 lesen wir: “Wer wissenschaftlich argumentiert und auf Studien verweist, inszeniert sich damit als besonders glaubwürdig. Manchmal ist das aber auch bloß ein gefährlicher Propagandatrick. […] Selbstinszenierung durch scheinbare Wissenschaftlichkeit” Zwar ist ein Verweis auf lediglich eine Studie meist wenig aussagekräftig, Florian Aigner schreibt aber von mehreren Studien, indem er den Plural gebraucht. Diese Vorgehensweise setzt er in einen Zusammenhang mit Selbstinszenierung und Scheinwissenschaft. Dieses Framing wirkt als starke Abwertung des empirischen Arbeitens.
Die Physik schließt Aigner aber davon aus, denn “[m]an kann einzelne Fragen [der Physik] isoliert betrachten und glasklar beantworten.” Einige sozialwissenschaftliche Fragen lassen sich jedoch ebenfalls eindeutig beantworten. Dies kann z.B. durch eine Umfrage geschehen. Und warum etwa heteroerotisches Verhalten häufiger ist als homoerotisches, lässt sich über einfache evolutionsbiologische Überlegungen auch leicht beantworten. Ob sich etwas mehr oder weniger schwierig aufklären lässt, hängt schließlich stark von der Fragestellung ab. Die Physik ist auch komplexer als Aigners Satz vermuten lässt. So lassen sich Quanten keineswegs “isoliert betrachten”. Weder die Frage nach der dunklen Materie noch der dunklen Energie47 ließ sich bislang “glasklar beantworten”.
Aigner fährt fort: “In Sozial- und Geisteswissenschaften […] hat man es mit viel komplexeren Systemen zu tun – mit dem Zusammenwirken unterschiedlicher Menschen zum Beispiel. Was bedeutet Freiheit? Wie gerecht ist unsere Gesellschaft? […] Gleichberechtigung ist keine Physik” Handlungsfreiheit48 ist jedoch ein bedeutend einfacheres Konzept als Quantenverschränkung. Bemerkenswert ist an dieser Textpassage, dass Aigner mit dem Begriff “gerecht” von der deskriptiven Ebene in die damit inkommensurable normative Kategorie abschweift. Was sein soll, lässt sich durch Empirie tatsächlich nicht klären. Das sind eigentlich auch keine sozialwissenschaftlichen, sondern sozialphilosophische und gesellschaftspolitische Fragen. Dies ist aber nicht schwer verständlich und deswegen allgemein bekannt. Normen zu postulieren hat nichts mit empirischer Wissenschaft zu tun, was darauf hindeutet, dass Florian Aigner Wissenschaft und Sozialphilosophie oder Politik nicht trennt.
Der Autor fragt weiter: “Wie gehen wir mit migrationsbedingten Integrationsproblemen um? Solche Fragen kann man nicht isoliert vom restlichen Universum betrachten.” Menschliche Migration ist kein neues Phänomen. Details über die Verhältnisse auf dem Mars, in unserer Galaxis oder dem restlichen Universum brauchten bei der Untersuchung aber noch nie betrachtet zu werden. Auch hier handelt es sich um eine politische und nicht in erster Linie um eine wissenschaftliche Frage, auch wenn wissenschaftliche Ergebnisse in die Politik einfließen können.
“Man verweist auf wissenschaftliche Studien und gaukelt eine naturwissenschaftsähnliche Präzision vor, die es in anderen Bereichen aber gar nicht geben kann. Das ist gefährlich. Denn bei komplexen Themen lässt sich fast jede Meinung mit irgendwelchen Studien belegen – auch wenn die Meinung gefährlicher Unsinn ist.” Hier werden nicht nur erhebliche Zweifel am Nutzen der empirischen Sozialforschung geäußert, sondern auch ihre potentielle Gefährlichkeit ins Spiel gebracht. Wenn eine Studie aber beliebige Schlussfolgerungen zulässt, ist sie empirisch leer und das Studiendesign war von vornherein ungeeignet. Genau genommen plädiert Aigner damit für die Unmöglichkeit von Sozialwissenschaft.
“In Gleichberechtigungsdebatten lässt sich das beobachten. Es gibt Umfragen, die sagen, dass teilzeitbeschäftigte Frauen zufriedener sind als vollzeitbeschäftigte. ‘Die Wissenschaft hat gesprochen!’ kann man nun sagen, und sich mächtig überlegen fühlen.” Eine derartige Umfrage hat zunächst nur das Ergebnis, dass Frauen häufig lieber in Teilzeit arbeiten. Um etwas über die Ursache dieser Vorliebe zu erfahren, sind zusätzliche Daten nötig. Die abschließende Bemerkung zu Überlegenheitsgefühlen ist unbelegt.
“‘Frauen wollen also keine Vollzeitjobs, Karriere ist ihnen nicht so wichtig, die Forderung nach beruflicher Gleichstellung ist somit unnatürlich!’” Frauen wollen aus zunächst unbekannten Gründen häufig keine Vollzeitjobs. Daraus folgt aber, dass sie tendenziell ein anderes Ziel der Karriere vorziehen. Aber wer behauptet eigentlich die obige Verbindung zwischen Gleichstellung und Unnatürlichkeit? Zunächst einmal bedeutet Gleichstellung im Gegensatz zu Gleichberechtigung streng genommen, dass Frauen in allen Berufen anteilsmäßig gleich vertreten sein müssen, also auch auf dem Bau oder bei der Müllabfuhr. Es ist fraglich, ob das gewünscht ist. Aus der Gleichberechtigung folgt weder die Gleichheit noch die Ungleichheit von Präferenzen. Eine numerische Parität, die auf Zwang statt auf Freiwilligkeit beruhte, könnte im Übrigen ohne weiteres als “unnatürlich” bezeichnet werden.
“Nur hat man dann eben nicht verstanden, wie Wissenschaft funktioniert. Nein, das sagt diese Studie nicht aus. Es handelt sich bloß um ein isoliertes Ergebnis, das nur Sinn ergibt, wenn man es als Teil eines hochkomplizierten Themengeflechts versteht.” Die Behauptung eine Umfrage löse ein sozialwissenschaftliches Problem, ist ein Strohmann.
“Woran liegt es denn, dass viele Frauen lieber Teilzeit arbeiten? Vielleicht daran, dass immer noch ein überwiegender Teil unbezahlter Pflegearbeit an Frauen hängenbleibt? Vielleicht an einem Betriebsklima, das immer noch von patriarchalen Hierarchien geprägt ist? Vielleicht an jahrtausendealten kulturell tradierten Vorstellungen, aus denen sich niemand von uns so leicht lösen kann?” Das sind alles empirische Fragen, die sich nicht schon allein durch bloßes Behaupten beantworten lassen.
“Oder man untersucht den Frauenanteil in technisch-naturwissenschaftlichen Studien und stellt fest: In Ländern wie Tunesien oder Algerien, die nicht unbedingt als Hochburgen der Emanzipation gelten, ist dieser Anteil erstaunlicherweise höher als in skandinavischen Ländern mit weit fortgeschrittener Geschlechtergleichberechtigung. Haben wir nun also wissenschaftlich bewiesen, dass sich wirklich gleichberechtigte Frauen in Wahrheit gar nicht für Naturwissenschaft interessieren?” Es kommt nicht darauf an, ob sich Frauen “gar nicht für Naturwissenschaften interessieren”, sondern ob es andere Bereiche gibt, für die sich Frauen mehr interessieren. Dafür gibt es den Begriff Präferenzordnung.
“Nein, natürlich nicht. Das ist eine völlig naive Verkürzung eines vielschichtigen Problems. So sind etwa Länder mit wenig ausgeprägter Geschlechtergleichstellung oft auch Länder mit geringerem Wohlstandsniveau, da ist vermutlich der Druck ein Studium zu wählen, das gutes Einkommen entspricht, auch für Frauen ein ganz anderer als in skandinavischen Ländern mit großzügigem Sozialsystem.” Falls sich das Verhalten von Frauen ändert, wenn der ökonomische Druck nachlässt, dann spricht das zunächst dafür, dass sie ihren Neigungen eher nachgehen können. Genau diesen Zusammenhang scheint der Autor aber widerlegen zu wollen. An der obigen Stelle argumentiert er jedoch für das Gegenteil. Das ist sehr verwirrend.
“Außerdem sind selbstverständlich auch skandinavische Länder noch weit davon entfernt, alte, kulturell tief verwurzelte Geschlechterungerechtigkeiten hinter sich gelassen zu haben.” Ob etwas als ungerecht angesehen wird, hängt von einer bestimmten politisch-ideologischen Position ab, die wiederum nichts mit Wissenschaft zu tun hat. Was das tatsächliche Verhalten von Frauen beeinflusst, ist wiederum eine empirische Frage, bei der Dogmatik nicht weiterhilft. Frauen bevorzugen z.B. Humanmedizin erheblich mehr als etwa Elektrotechnik. Verdient man mit Medizin wirklich weniger als mit Elektrotechnik? Das darf bezweifelt werden. Man kann sich auch fragen, ob etwa Annalena Baerbock, Angela Merkel, Ursula von der Leyen, Sahra Wagenknecht oder Alice Weidel wirklich naturwissenschaftliche Kenntnisse brauchten, um ihre herausgehobenen Positionen zu erreichen. Ingenieurwissenschaften sind im Bundestag unterrepräsentiert, Jura ist hingegen überrepräsentiert. Es ist unplausibel, dass insbesondere die Naturwissenschaften ein besonders guter Weg zu Spitzeneinkommen oder großer Macht sind. Florian Aigner scheint es sich hier zu einfach zu machen.
“Natürlich sind solche Studien interessant. Auch bei komplexen Themen soll man sich auf Zahlen und Fakten stützen.” Nachdem der bisherige Artikel sozialwissenschaftliche Empirie madig machte, findet nun ein Teilrückzug statt.
“Auch mit Fakten kann man lügen – wenn man einen kleinen Teil der Fakten isoliert betrachtet, obwohl sich nur im Kontext mit vielen anderen Fakten ein sinnvolles Gesamtbild ergeben würde.” Das Gegenteil wird in der Wissenschaft nicht behauptet und ist somit wieder ein Strohmann.
Paradox der Gleichberechtigung
Damit wird es sehr plausibel, dass Florian Aigner das sog. Gleichberechtigungsparadox49 im Sinn zu haben scheint. Eine gängige sozialwissenschaftliche Vorhersage lautet, dass sich Frauen und Männer in ihrer Persönlichkeit und ihren Präferenzen immer mehr ähneln sollten, je mehr die gesellschaftliche Gleichberechtigung50 zunimmt. Empirische Studien zeigen jedoch das Gegenteil. Mit mehr Gleichberechtigung werden sich Frauen und Männer eher unähnlicher.51 Mittlerweile erlangen mehr Frauen als Männer eine Hochschulbildung.52 Die Fächerwahl unterscheidet sich jedoch deutlich: “Frauen dominieren in sozialen Fachrichtungen, Männer in den technischen Fächern.”53
Für diesen Unterschied sind theoretisch zwei Ursachen denkbar: evolutionär erworbene Eigenschaften oder gesellschaftlicher Druck. Damit Frauen erfolgreich ein Hochschulstudium absolvieren, bedurfte es weder eines Zwangs noch einer Quote. Die Tatsache, dass es früher aufgrund von aus heutiger Sicht unvertretbaren Zugangsbeschränkungen längere Zeit nur Männer an den Universitäten gab, sollte eigentlich das Stereotyp54 “Studieren ist nichts für Frauen” gesellschaftlich verfestigt haben. Das hat Frauen aber nicht vom Studium abgehalten. Alles deutet darauf hin, dass Frauen freiwillig eine höhere Bildung anstreben. Schließlich ist auch durch Tests belegt, dass Frauen die gleiche mittlere Intelligenz haben wie Männer. Dies spricht zunächst nicht dafür, dass alte Rollenvorstellungen einen besonders nachhaltig großen Einfluss haben müssten.
Warum aber wählen Frauen statistisch gesehen andere Studienfächer als Männer? Aus sozialwissenschaftlicher Sicht schlagen Breda et al. (2020)55 als alleinige Erklärung dafür allerdings genau Geschlechterstereotype vor. Sie behaupten, dass essentialistische Geschlechternormen in Bezug auf mathematische Begabungen und angemessene Berufswahl das Paradox der Geschlechtergleichberechtigung vollständig erklären. Wirtschaftliche Entwicklung und ein erhöhtes Maß an Gleichberechtigung schwäche Geschlechternormen nicht, sondern führe nur zu ihrer Umgestaltung. Dies sei durch ihre statistische Untersuchung auch belegt.56
Dazu analysieren Breda et al. (2020) Daten der PISA-Studie von 2012. Als Maß für sog. verinnerlichte geschlechtsspezifische Stereotype in Bezug auf Mathematik dienen Fragen zu subjektiven Normen und wahrgenommener Kontrolle in Mathematik:
- “Doing well in math is completely up to me.”
- “My parents believe that math is important for my career.”
Das unterschiedliche Ausmaß, in dem Mädchen und Jungen diesen Aussagen zustimmen, soll die monokausale Ursache für ihr unterschiedliches Verhalten darstellen. Dass es sich um Kofaktoren handeln könnte, wird anscheinend ausgeschlossen.
Breda et al. (2020) konzentrieren sich auf das Fach Mathematik. Im Artikel kommt “math” ca. 90 mal vor, “engineering” oder “technology” aber nur 2 mal. Ist der Frauenanteil bei der Mathematik tatsächlich besonders niedrig? Das Statistische Landesamt Baden‑Württemberg veröffentlichte57 dazu 2022: “Doch MINT ist nicht gleich MINT. Während der Frauenanteil in der Fächergruppe Mathematik, Naturwissenschaften bereits seit drei Jahren in Folge bei über 50 % lag, war der Frauenanteil in der Fächergruppe Ingenieurwissenschaften mit 23 % nicht einmal halb so groß.”58 Das macht es nicht gerade plausibel, dass Frauen Mathematik auffällig meiden. Der eigentliche Unterschied besteht eher bei den Ingenieurswissenschaften, die von Natur aus weniger mathematiklastig sind als die Mathematik selbst:
- Mathematik: 4188 Männer (~45%), 5198 Frauen (~55%)
- Elektrotechnik: 9403 Männer (~85%), 1600 Frauen (~15%)
Wie kann es sein, dass die behauptete gesellschaftliche Norm “Mathematik ist nichts für Mädchen” bei der eigentlichen Mathematik viel weniger wirksam ist als bei den anwendungsorientierten Ingenieurswissenschaften?
Merkwürdig auch, dass der selbe Erstautor Breda zusammen mit Napp59 ein Jahr zuvor in einer anderen Studie eine alternative Erklärung lieferte, die vor allem auf Leistungsunterschieden der Schüler zwischen Mathematik und Lesen beruhte. Während Mädchen und Jungen in Mathematik ähnliche Leistungen erzielen, sind Mädchen den Jungen bei der Leseleistung deutlich überlegen. Daher könne es sein, dass eine Schülerin, die gut in Mathematik, aber noch besser im Lesen ist, sich für Geisteswissenschaften interessiere, weil sie sich selbst als sprachbegabt wahrnehme.
Das passt nicht so recht zur monokausalen Erklärung der 2020er Studie von Breda et al. Eine Gemeinsamkeit besteht aber darin, dass beide Studien einen reinen Sozialkonstruktivismus unterstellen. In seiner konsequentesten Form reicht der Sozialkonstruktivismus, wie er von Simone de Beauvoir und Judith Butler propagiert wurde, bis in reproduktionsbiologische Aspekte hinein. John Money prägte die Begriffe “gender role”60 und “gender identity”61. Das Konzept besteht aus einer geschlechtsneutralen Geburt mit anschließender erzieherischer Prägung in eine maskuline oder feminine Richtung. In einem später als ethisch fragwürdig kritisierten Experiment62 erprobte Money dieses Konzept. Ein Junge mit operativ beschädigten Genitalien sollte zum Mädchen umerzogen werden. Von Judith Butler positiv aufgenommen, wurde das Experiment später aber als gescheitert63 angesehen, da es mit Selbstmord endete.
Demgegenüber haben wissenschaftliche Untersuchungen gezeigt, dass sich Frauen und Männer genetisch stärker unterscheiden als allgemein angenommen,64 und die geschlechtsspezifische Medizin hat festgestellt, dass Frauen und Männer unterschiedliche Krankheitssymptome haben und unterschiedlich auf Medikamente reagieren.65
Das alles scheint einem Sozialkonstruktivismus Grenzen zu setzen, der das Konzept “Frau == Mann” vertritt. Die Ergebnisse deuten eher darauf hin, dass sowohl angeborene Eigenschaften als auch Erziehung und soziale Einflüsse wirksam sind. Dass unser evolutionäres Erbe einfach so vernachlässigt werden kann, erscheint dagegen wenig plausibel.
Sein und Sollen
Die Verwechslung von Sein und Sollen ist eine häufige Quelle der Verwirrung. Aus dem Sein folgt nämlich kein Sollen und aus dem Sollen folgt kein Sein. Sollen muss lediglich Können implizieren, um eine Norm überhaupt befolgen zu können. Tatsachen lassen sich nicht einfach herbeiwünschen, teilweise aber durch Handeln herbeiführen oder erzwingen. Tatsachen aus der Vergangenheit sind überhaupt nicht beeinflussbar und bislang spricht alles dafür, dass Naturgesetze auch in Zukunft nicht abänderbar sind. Naturgesetze schränken die Klasse der möglichen künftigen Tatsachen ein. Des weiteren können (und sollten) Normen ausgehandelt werden, während bestehende Tatsachen nicht verhandelbar sind. Die Rekonstruktion von Tatsachen kann umstritten sein, wie es z.B. öfters in Mordprozessen vorkommt.
Florian Aigner wechselt nicht nur einmal unvermittelt von der deskriptiven Seinsebene auf die normative Ebene des Sollens. Wenn er z.B. von geschlechtsspezifischen Ungleichheiten bei der Wahl unterschiedlicher Studienfächer spricht, scheint er zu implizieren, dass Gerechtigkeit erst dann gegeben ist, wenn die Verteilung der Präferenzen von Frauen und Männern exakt gleich sind. Das ist jedoch nur eine Behauptung, die sich in Frage stellen lässt. Erzwungene Gleichmacherei würde wohl kaum als Gerechtigkeit empfunden. Absolute faktische Gleichheit (d.h. “Gleichstellung”) ist keine notwendige Voraussetzung für Gleichberechtigung oder Wertschätzung. Wenn es um wissenschaftliche Themen geht, stimmt Florian Aigner dem ausdrücklich zu, denn Unterschiedliches soll gleichwertig sein. Bei geschlechtsabhängigen Präferenzen soll dies anscheinend nicht gelten. Das weckt aber den Verdacht doppelter Standards.
Motte und Bailey
F. Aigner: “Selbstverständlich diskutieren nicht alle Leute aus der Naturwissenschaft auf solch eindimensionale Weise. Aber es kommt vor. Die Wahrheit ist: Wenn wir in dieser komplizierten Welt zurechtkommen wollen, in der alles mit allem irgendwie zusammenhängt, dann brauchen wir kluge Ideen aus allen Wissensbereichen. Verschiedene Forschungsdisziplinen gegeneinander auszuspielen, ist die dümmste Streiterei der Welt.”
In dieser Schlusspassage folgt wieder ein Teilrückzug. Dieses Muster ähnelt dem Argumentationsschema “Motte und Bailey”66. Man beginnt mit einer kontroversen und schwer zu verteidigenden Aussage (Bailey, Burghof). Wenn daran Kritik geübt wird, wechselt man zu einer harmloseren Aussage (Motte, Turmhügelburg), die eher akzeptiert wird.
Warum Florian Aigner so argumentiert, können wir nicht genau wissen. Wir können aber wohl sicher ausschließen, dass der Autor zu einer sorgfältigen Recherche nicht in der Lage ist. Die Texte sind eher im Zusammenhang mit der Spaltung der Skeptiker-Bewegung in Deutschland67 zu sehen. Dort hatte sich ein neues linksidentitäres Denken entwickelt, das mit dem zuvor vertretenen Universalismus unvereinbar war. Ersteres stellt eine dogmatische Moral über die wissenschaftliche Wahrheit. Der moralistische Fehlschluss (aka inverser naturalistischer Fehlschluss) ist dabei nicht ungewöhnlich: Was von einem bestimmten Moralstandpunkt aus wünschenswert erscheint, sei auch der Fall. Insofern ist es nicht unplausibel, dass es in den analysierten Texten von Florian Aigner weniger um wissenschaftliche Aufklärung als um Tugendsignalisierung geht.
Fazit
Florian Aigner ist ein kompetenter Physiker und Wissenschaftsessayist.68 Das kommt in den beiden untersuchten Meinungsartikeln aber nicht so recht zum Ausdruck:
- Unschärfen: Begriffliche Unschärfen können das Textverständnis erschweren. Dass der Eindruck entstehen kann, die Mathematik sei eine Naturwissenschaft, ist vielleicht zu verschmerzen. Dass Naturwissenschaft “Formel[n] auf den Tisch knallt” erscheint auch zu kurz gegriffen. Der Begriff Geschlecht hat inzwischen jedoch so radikal unterschiedliche Bedeutungen angenommen, dass er sich heute überhaupt nicht mehr ohne vorherige Erläuterung verwenden lässt.
- Bias: Durch einseitige Auswahl der Beispiele entsteht ein deutlicher Selektionsbias. Vermeintliche Überlegenheit gibt es nicht nur im Bereich der Naturwissenschaft, sondern hat auch in den Geisteswissenschaften eine lange Tradition. Man könnte nach der Lektüre auch meinen, dass der weitreichende Sozialkonstruktivismus überhaupt keine ernstzunehmende Kritik erfahren hat, was aber nicht der Fall ist.
- Strohmänner: Strohmannargumente trüben den Texteindruck. Schließlich ist eine willkürliche Anwendung der Mathematik nicht nur in der Soziologie, sondern auch in der Physik keine gute Wissenschaft. Die Evolutionspsychologie leugnet auch keineswegs den Einfluss kultureller Überformungen.
- Unangemessene Einordung der Empirie: Der wissenschaftstheoretische Diskurs über das Verhältnis von Theorie und Empirie ist nicht einfach einer zwischen der Naturwissenschaft und Sozialwissenschaft, sondern wird auch innerdisziplinär geführt. Die Empirie in den Sozial- und Biowissenschaften erhält in den Texten außerdem ein sehr abwertendes Framing: Es fallen Begriffe wie Propaganda und Scheinwissenschaft.
- Kategoriefehler: Es besteht die Tendenz, Sozialwissenschaft mit Sozialphilosophie und politischem Aktivismus zu verwechseln. Beschreibung und Normen werden nicht auseinander gehalten. Die Sozialwissenschaft ist nicht für die Setzung gesellschaftlicher Normen zuständig. Normen sollten vielmehr in einem fairen Diskurs gesellschaftlich ausgehandelt werden, wobei auch wissenschaftliche Ergebnisse zu berücksichtigen sind.
- Verdacht auf manipulative Rhetorik: Die zwei analysierten Texte folgen dem Muster, dass zunächst starke Behauptungen aufgestellt werden, worauf ein Teilrückzug erfolgt. Beschuldigungen werden nicht belegt. Das ist keine gute Argumentation.
Wir haben uns die Ausführungen von Florian Aigner zu geschlechtsspezifischen Präferenzen und zum Gleichberechtigungsparadox genauer angesehen und auch die Fachliteratur dazu konsultiert. Die von Aigner kritisierte Unreflektiertheit ließ sich nicht feststellen: Mit unterschiedlichen Methoden wird empirisch untersucht, ob es angeborene Präferenzen gibt oder ob alles sozial konstruiert ist. Dass normative Stereotype allein unterschiedliches Verhalten erklären, ist angesichts der Ergebnisse wenig plausibel. Florian Aigner scheint auch dem Irrtum zu unterliegen, dass verwirklichte Gleichberechtigung zwingend faktische Gleichheit implizieren muss.
So sind die Texte leider durchsetzt von Unschärfen, Selektionsbias, Framing, Kategorienfehlern und Strohmannargumenten. Das macht es nicht einfacher, herauszufinden, wofür der Autor denn im positiven Sinne steht.
Es fällt auf, dass starke Werturteile gefällt werden, wie Selbstüberschätzung, vermeintliche Seriosität, Gedankenlosigkeit, unangemessene Siegesgewissheit, vorgetäuschte Glaubwürdigkeit, gefährliche Propaganda und Unsinn, fehlgeleitete Überlegenheitsgefühle, Lügen, Tatsachenvortäuschung und Scheinwissenschaftlichkeit.
Damit lässt sich eine Tendenz in den Texten feststellen, nämlich eine Betonung des Moralismus gegenüber der Empirie, auch wenn es sich nicht um Normen, sondern um Tatsachen handelt. Wenn die empirischen Sozialwissenschaften jede Meinung belegen können, sind sie de facto desavouiert. Um ohne Bezug auf Tatsachenfeststellungen dennoch zu entscheiden, ob eine “Meinung gefährlicher Unsinn” ist oder nicht, bleibt dann nur der Rückgriff auf eine moralische Doktrin. Die Annahme, dass es in den Texten gar nicht um Wissenschaft geht, sondern um eine zeitgeistige Tugendsignalisierung, erscheint daher plausibel.
Fußnoten
-
Ich möchte mich herzlich bei Varnan Chandreswaran, Andreas Edmüller, Judith Faessler, Martin Mahner, Nikil Mukerji, Markus Neubauer und Stefan Uttenthaler für ihre wertvollen Hinweise und anregenden Diskussionen bedanken. Ihre Unterstützung hat wesentlich zur Weiterentwicklung dieses Artikels beigetragen. Alle im Artikel geäußerten Ansichten und Schlussfolgerungen liegen jedoch in meiner alleinigen Verantwortung.↩︎
-
“About the Committee for Skeptical Inquiry”, skepticalinquirer.org↩︎
-
“As he [the late Paul Kurz] said, ‘We originally criticized pseudoscientific, paranormal claims because we thought that they trivialized and distorted the meaning of genuine science.’ […] But, he continued, “Many of the attacks on the integrity and independence of science today come from powerful political-theological-moral doctrines.” In Kendrick Frazier: “Why We Do This: Revisiting the Higher Values of Skeptical Inquiry”, Skeptical Inquirer 37(6), 2013, ↩︎
-
S. Vyse: “Shakeup among German Skeptics”, 2023,skepticalinquirer.org.↩︎
-
Im Rahmen der Diskussion wurde sogar bestritten, dass der Begriff “Critical Studies” überhaupt gebräuchlich sei. Siehe jedoch Akademie der bildenden Künste Wien: “Master in Critical Studies”, akbild.ac.at, archive.org. Oder Leuphana Universität Lüneburg: “Center for Critical Studies”, leuphana.de, archive.org.↩︎
-
M. Mahner: “Warum die sog. ‘Critical Studies’ unter Pseudowissenschaftsverdacht stehen”, MIZ 1, 2023, miz-online.de.↩︎
-
“we skeptical inquirers, do it all. […] The only requirement is a commitment to science and reason, to evidence, and to the quest for truth”, in Kendrick Frazier: “You Can’t Fit What We Skeptics Do into a Neat Box”, Skeptical Inquirer 43(2), 2019.↩︎
-
Nach Wikipedia erhielt Florian Aigner fünf verschiedene Auszeichnungen für seine populärwissenschafliche Arbeit.↩︎
-
“Florian Aigner ist Physiker und Wissenschaftserklärer. Er beschäftigt sich nicht nur mit spannenden Themen der Naturwissenschaft, sondern oft auch mit Esoterik und Aberglauben, die sich so gerne als Wissenschaft tarnen. Über Wissenschaft, Blödsinn und den Unterschied zwischen diesen beiden Bereichen, schreibt er regelmäßig auf futurezone.at und in der Tageszeitung KURIER.” Aus futurezone.at, archive.org.↩︎
-
Florian Aigner: “Die GWUP: Zwischen Wissenschaft und Ideologie”, April 2024, florianaigner.at, archive.is.↩︎
-
Gesellschaft für kritisches Denken, skeptiker.at, archive.org.↩︎
-
Ulrich Berger: “GWUP zwischen Wissenschaft und Ideologie? Ein offener Brief”, scienceblogs.de.↩︎
-
Florian Aigner auf Bluesky am 14.1.2026: “Diese alte Skeptikerszene, die völlig ohne Moral und politisches Verständnis argumentiert, ist nicht einfach nur auf dem falschen Weg, sie ist inzwischen gefährlich. Wer dort immer noch dabei ist, sollte dringend austreten. Geht lieber zu vernünftigen, mitfühlenden Skeptikergruppen wie @skeptix.org”, Screenshot↩︎
-
Florian Aigner: “Die Selbstüberschätzung der Naturwissenschaft”, 31.8.2024, futurezone.at, archive.org.↩︎
-
“Schädelform und Hirnfunktion”, medizin.uni-muenster.de, archive.org↩︎
-
Die Einteilung der Wissenschaften in Natur-, Sozial- und Geisteswissenschaften ist zu einfach. So spricht man im Englischen meist von Humanities (für kulturbezogene Fächer) oder Social Sciences (für gesellschaftsbezogene Fächer). Der deutsche Begriff „Geisteswissenschaften“ entspricht keiner dieser Kategorien. Durch interdisziplinäre Entwicklungen überschneiden sich viele Fächer. Es gibt moderne Begriffe wie Kultur- oder Humanwissenschaften. Dieses Klassifikationsproblem ist nicht trivial und kann daher im Rahmen dieses Beitrags nicht vertieft werden.↩︎
-
“This book is not an impartial description and dispassionate analysis of the current state of the social sciences and sociotechnologies. Far from gloating over accomplishments, it focuses on flaws likely to be rooted in either mistaken philosophies or ideological dogmas. This admittedly unbalanced selection should not give the impression that contemporary social science is all warts. I do believe that social science has been advancing and can continue to do so - provided it resists the bulldozing of “postmodern” irrationalism. But I have chosen to highlight some of the philosophical obstacles to further advancement. Other scholars are likely to note flaws of a different kind, such as neglect of the- ories of social changes and mechanisms (e.g., Sørensen 1997) and insufficient longitudinal data to test those theories (e.g., Smith and Boyle Torrey 1996).” Auf Seite x in Mario Bunge: “Social Science under Debate - A Philosophical Perspective”, University of Toronto Press, 1998, 552 Seiten.↩︎
-
Die folgenden Literaturhinweise sollen nur exemplarisch belegen, dass es auch außerhalb der Naturwissenschaften insbesondere von geisteswissenschaftlicher Seite Kritik an den Gender Studies und ihren Grundlagen gibt. Die Liste ließe sich verlängern.
Paul Boghossian (Philosophie):
“Fear of Knowledge: Against Relativism And Constructivism”, Oxford University Press, 2006, 139 Seiten.Christina Hoff-Sommers (Philosophie): “Who Stole Feminism?: How Women Have Betrayed Women”, Simon & Schuster, Revidierte Ausgabe, 1995, 320 Seiten.
Martin Mahner (Philosophie, Biologie):
“Warum die sog. „Critical Studies“ unter Pseudowissenschaftsverdacht stehen”, MIZ 1, 2023, miz-online.de.Camille Paglia (Kunst-, Kulturgeschichte):
“Sexual Personae: Art and Decadence from Nefertiti to Emily Dickinson”, Yale University Press. 1990, 732 Seiten.
“Junk Bonds and Corporate Raiders: Academe in the Hour of the Wolf”, Arion: A Journal of Humanities and the Classics 1(2), 1991, S.139-212, jstor.org.
Zitate: stevestewartwilliams.com, archive.org.Daphne Patai (Sprache, Literatur) und Noretta Koertge (Wissenschatstheorie):
“Professing Feminism: Education and Indoctrination in Women’s Studies”, Lexington Books, expanded edition, 2003, 426 Seiten.Harald Schulze-Eisentraut (Archäologie) und Alexander Ulfig (Philosophie, Soziologie):
“Gender-Studies - Wissenschaft oder Ideologie?”, Deutscher Wissenschaftsverlag, 3. Aufl., 2020, 250 Seiten.
Sammelband mit 12 Autoren, 9 davon aus den Fachgebieten Archäologie, Erziehungswissenschaft, Germanistik, Literaturwissenschaft, Philosophie, Soziologie, Sprachwissenschaft, Volkswirtschaftslehre.Steven Pinker (Psychologie, Kognition, Linguistik):
“The Blank Slate”, Allen Lane, 2002, Chapter 18 “Gender”.
“Das unbeschriebene Blatt”, Fischer, 2. Auflage, überarbeitete Neuausgabe, 2017, Kapitel 18 “Geschlecht”.Janice G. Raymond (Women’s Studies, Medizinethik):
“Doublethink: A Feminist Challenge to Transgenderism”, Spinifex Press, 2021, 300 Seiten.Vojin Saša Vukadinović (Geschichte):
“Die Sargnägel des Feminismus?”, Emma, 28. Juli 2017, emma.de, Online-Titel wurde geändert in “Butler erhebt”Rassismus”-Vorwurf”.Uwe Steinhoff (Philosophie):
“Erwiderung auf Juliane Jünglings und Geert Keils Zeit-Artikel ‘Wovon hängt ab, wer eine Frau ist?’”, 16.12.2022, uwesteinhoff.com, archive.org.Kathleen Stock (Philosophie):
“Material Girls -Warum die Wirklichkeit für den Feminismus unerlässlich ist”, Verlag Edition Tiamat, 2022.↩︎ -
“Francis Bacon appealed to rape metaphors to persuade his audience that experimental method is a good thing: ‘For you have but to hound nature in her wanderings and you will be able when you like to lead and drive her afterwards to the same place again. Neither ought a man to make scruple of entering and penetrating into those holes and corners when the inquisition of truth is his whole object’” (Harding, 1991, S.43)
“Bacon’s mentor was James I of England, a strong supporter of antifeminist and antiwitchcraft legislation in both England and Scotland. An obsessive focus in the interrogations of alleged witches was their sexual practices, the purpose of various tortures being to reveal whether they had ‘carnally known’ the Devil. In a passage addressed to his monarch, Bacon uses bold sexual imagery to explain key features of the experimental method as the inquisition of nature: […]. There does […] appear to be reason to be concerned about the intellectual, moral, and political structures of modern science when we think about how, from its very beginning, misogynous and defensive gender politics and the abstraction we think of as scientific method have provided resources for each other. […] It might not be immediately obvious to the modern reader that this is Bacon’s way of explaining the necessity of aggressive and controlled experiments in order to make the results of research replicable! […] Both nature and inquiry appear conceptualized in ways modeled in rape and torture - on men’s most violent and misogynous relationships to women - and this modeling is advanced as a reason to value science.” (Harding, 1986, 115-116)
Ähnliche Kritik an Bacon auch in Merchant (1980, S.168) und Keller (1985, S.35).Sandra Harding: “Whose Science? Whose Knowledge? Thinking from Women’s Lives”, Cornell University Press, 1991.
Sandra Harding: “The science question in feminism”, Cornell University Press, 1986, Google Books.
Carolyn Merchant: “The Death of Nature: Women, Ecology, and the Scientific Revolution”, Harper, 1980.
Evelyn Fox Keller: “Reflections on Gender and Science”, Yale University Press, 1985.Gegen diese Behauptungen argumentieren:
Noretta Koertge: “Methodology, Ideology and Feminist Critiques of Science”, Proceedings of the Biennial Meeting of the Philosophy of Science Association Vol 2, 1980, S.346-359, doi.org, jstor.org.Iddo Landau: “Feminist Criticisms of Metaphors in Bacon’s Philosophy of Science”, Philosophy 73(1), 1998, S.47-61, doi.org.
Alan Soble: “In Defence of Bacon”, Philosophy of the Social Sciences 25(2), 1995, S.192-215, doi.org.
Alan Sokal: “Beyond the Hoax: Science, Philosophy, and Culture”, Oxford University Press, 2008, S.119-123.↩︎
-
Yascha Mounk: “Im Zeitalter der Identität - Der Aufstieg einer gefährlichen Idee”, Klett-Cotta Verlag, 2024 , 512 Seiten.↩︎
-
Jerry A. Coyne and Luana S. Maroja: “The Ideological Subversion of Biology”, Skeptical Inquirer 47(4), July/August 2023, S.34-47, skepticalinquirer.org, archive.org, ca. 100 Literaturangaben in der Printversion.
Deutsche Übersetzung des Artikels: de.richarddawkins.net, archive.org.↩︎ -
Erläuterung des modelltheoretischen Arguments von Hilary Putnam.↩︎
-
Mario Bunge: “Treatise on Basic Philosophy - Volume I”, Reidel, 1974, S.VII.↩︎
-
Todsünde, wikipedia.de.↩︎
-
Von Dietrich Schwanitz’ “Bildung - Alles was man wissen muss”, 1999, hat Eichborn mindestens 27 und Goldmann 21 Auflagen herausgegeben.↩︎
-
Dietrich Schwanitz: “Bildung - Alles was man wissen muss”, Eichborn, 13. Auflage, 2003, S.482.↩︎
-
Judith Butler: “Das Unbehagen der Geschlechter”, Suhrkamp, 2016, getabstract.com.↩︎
-
“Language is not a neutral transmitter of a universal, objective, or fixed reality. Rather, language is the way we construct reality, the framework we use to give meaning to our experiences and perceptions within a given society. Language is also cultural, making it dependent on the historical and social moment in which it is used”,
in Özlem Sensoy and Robin DiAngelo: “Is Everyone Really Equal? An Introduction to Key Concepts in Social Justice Education”, 2017, second Edition, Teachers College Press, Teachers College, Columbia University, S.70.↩︎ -
Der idealistische Platonismus behauptet zwar, dass mathematische Objekte losgelöst von der materiellen Welt existieren, aber dies konnte noch nie belegt werden. Es ist auch höchst unklar, wie solche Entitäten denn mit dem menschlichen Gehirn interagieren könnten.↩︎
-
Sabine Hossenfelder: “Lost in Math: How Beauty Leads Physics Astray”, Basic Books, 304 Seiten, 2018.↩︎
-
Ein Steroid-5α-Reduktase-Mangel (5-ARD) stört zwar die Ausbildung männlicher Geschlechtsorgane, in der Pubertät findet aber dennoch eine Maskulinisierung der Physis unter Testosteronwirkung statt. Diskussionsbeispiel auf x.com, archive.ph vom 21.9.2023.↩︎
-
E.N. Hilton, T.R. Lundberg: “Transgender Women in the Female Category of Sport: Perspectives on Testosterone Suppression and Performance Advantage”, Sports Medicine 51, 2021, S.199–214, doi.org.↩︎
-
M. Mahner und M. Bunge: “Function and Functionalism: A Synthetic Perspective”, Philosophy of Science 68(1), 2001, S.75-94, doi.org. M. Mahner und M. Bunge: “Philosophische Grundlagen der Biologie”, Springer, 2000, S.148ff.↩︎
-
“Was bedeutet ‘normativ’? Bedeutung, Definition, Erklärung”, bedeutungonline.de,
“Normativ”, de.wikipedia.org.↩︎ -
KI-Sprachmodelle sind heuristische Mittel, um rasch Hinweise auf häufige Verwendungsweisen von Begriffen zu erhalten, da sie ja mit vielen Texten gefüttert wurden. Heuristisch relevant ist auch der Vergleich der Ausgaben unterschiedlich trainierter Sprachmodelle. Es folgen die Antworten dreier KI-Instanzen am 23.1.2025 auf die Frage: “Was ist eine Geschlechterrolle?”: Eine Geschlechterrolle
“bezeichnet die gesellschaftlich und kulturell geprägten Erwartungen, Verhaltensweisen, Normen und Aufgaben, die mit einem bestimmten Geschlecht […] verbunden sind. Sie beeinflussen, wie Menschen aufgrund ihres Geschlechts wahrgenommen werden, wie sie sich selbst sehen und wie sie sich in sozialen Kontexten verhalten.” (ChatGPG)
“ist die Summe von Verhaltensweisen, Eigenschaften und Erwartungen, die in einer Kultur für ein bestimmtes Geschlecht als typisch oder akzeptabel gelten und Personen zugeschrieben werden. Sie umfasst sowohl die gesellschaftlichen Vorstellungen darüber, wie sich Personen eines bestimmten Geschlechts verhalten sollten, als auch die individuellen Verhaltensweisen, mit denen Menschen ihre Geschlechtsidentität zum Ausdruck bringen.” (Perplexity)
“bezieht sich auf die Summe von Verhaltensweisen, die in einer Kultur für ein bestimmtes Geschlecht als typisch oder akzeptabel gelten. Diese Rollen sind gesellschaftliche Erwartungen, wie sich Männer und Frauen verhalten sollen. Sie variieren von Kultur zu Kultur und können sich im Laufe der Zeit ändern.” (Copilot)↩︎
-
“Evolutionäre Psychologie”, spektrum.de , archive.org.↩︎
-
S.M. Downes: “Evolutionary Psychology”, The Stanford Encyclopedia of Philosophy, Spring 2024, E.N. Zalta & U. Nodelman (Hrsg.), plato.stanford.edu.↩︎
-
Steven Pinker: “The Blank Slate”, Allen Lane, 2002, 528 Seiten. Deutsche Übersetzung: “Das unbeschriebene Blatt”, Fischer, 2. Auflage, überarbeitete Neuausgabe, 2017, 768 Seiten.↩︎
-
Gilbert Ryles “Ghost in the machine”, en.wikipedia.org.↩︎
-
J.M. Hassett et al.: “Sex differences in rhesus monkey toy preferences parallel those of children”, Hormones and Behavior 54(3), 2008 , S.359–364, doi.org.↩︎
-
T. Shirazi et al.: “Low Perinatal Androgens Predict Recalled Childhood Gender Nonconformity in Men”, Psychological Science 33(3), S.343–353, 2022, doi.org.↩︎
-
R. Balasubramanian: “Isolated Gonadotropin-Releasing Hormone (GnRH) Deficiency”, NIH, National Library of Medicine, 2022, ncbi.nlm.nih.gov, archive.org.↩︎
-
A. Falk und J. Hermle: “Relationship of gender differences in preferences to economic development and gender equality”, Science 362(6412), 2018, doi.org.↩︎
-
Walter et al.: “Sex Differences in Mate Preferences Across 45 Countries: A Large-Scale Replication”, Psychological Science 31(4), S.408-423, 2020, doi.org.↩︎
-
S. Ryali et al.: “Deep learning models reveal replicable, generalizable, and behaviorally relevant sex differences in human functional brain organization”, Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA 121(9), 2024,doi.org.↩︎
-
Florian Aigner: “Aber eine Studie hat gesagt”, 03.02.2024, futurezone.at, archive.org.↩︎
-
A. Seifert: “Supernovae evidence for foundational change to cosmological models”, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society: Letters 537(1), 2025, L50-L60, doi.org↩︎
-
Die Philosophie analysiert den Freiheitsbegriff schon sehr lange. Siehe “Freier Wille - ein Widerspruch?”, feodor.de.↩︎
-
F. Luerweg: “Das Paradox der Gleichberechtigung”, spektrum.de, archive.org.
“Gender-equality paradox”, en.wikipedia.org.↩︎ -
F. Luerweg: schreibt auf spektrum.de: “Mit zunehmender Gleichstellung scheinen sich Frauen und Männer nicht ähnlicher, sondern im Gegenteil immer unähnlicher zu werden – in ihrer Persönlichkeit ebenso wie bei der Wahl des Studienfachs.” Das erzeugt den Anschein eines Widerspruchs, denn der Begriff “Gleichstellung” bedeutet ja gerade Ergebnisgleichheit und nicht Chancengleichheit.↩︎
-
G. Stoet, D.C. Geary: “The Gender-Equality Paradox in Science, Technology, Engineering, and Mathematics Education”, Psychological Science 29(4), 2018, [doi.org][https://doi.org/10.1177/0956797617741719].
G. Stoet, D.C. Geary: “The gender-equality paradox in science, technology, engineering, and mathematics education”: Corrigendum. Psychological Science, 31(1), 2020, 110-111, doi.org.
G. Stoet, D.C. Geary:: “Sex differences in adolescents’ occupational aspirations: Variations across time and place.”, PLoS ONE 17(1): e0261438, 2022, doi.org.
P.T. Costa, A. Terracciano, R.R. McCrae: “Gender differences in personality traits across cultures: Robust and surprising findings”, Journal of Personality and Social Psychology 81(2), 2001, 322–331, doi.org.
Siehe auch Falk und Hermle (2018).↩︎ -
Mehr Frauen als Männer mit Hochschulbildung, Deutschland: de.statista.com, USA: census.gov.↩︎
-
Unterschiedliche Studienfachrichtungen bei Frauen und Männern, destatis.de, archive.org.↩︎
-
duden.de: “vereinfachendes, verallgemeinerndes, stereotypes Urteil, [ungerechtfertigtes] Vorurteil über sich oder andere oder eine Sache; festes, klischeehaftes Bild”.↩︎
-
Breda et al.: “Gender stereotypes can explain the gender-equality paradox”, Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA 117(49), 2020, 31063–31069, doi.org, Supplementary Information.↩︎
-
Breda et al. (2020): “The so-called ‘gender-equality paradox’ is the fact that gender segregation across occupations is more pronounced in more egalitarian and more developed countries. Some scholars have explained this paradox by the existence of deeply rooted or intrinsic gender differences in preferences that materialize more easily in countries where economic constraints are more limited. In line with a strand of research in sociology, we show instead that it can be explained by cross-country differences in essentialist gender norms regarding math aptitudes and appropriate occupational choices. To this aim, we propose a measure of the prevalence and extent of internalization of the stereotype that ‘math is not for girls’ at the country level. This is done using individual-level data on the math attitudes of 300,000 15-y-old female and male students in 64 countries. The stereotype associating math to men is stronger in more egalitarian and developed countries. It is also strongly associated with various measures of female underrepresentation in math-intensive fields and can therefore entirely explain the gender-equality paradox. We suggest that economic development and gender equality in rights go hand-in-hand with a reshaping rather than a suppression of gender norms, with the emergence of new and more horizontal forms of social differentiation across genders.”↩︎
-
Statistisches Landesamt Baden‑Württemberg, statistik-bw.de, archive.org.↩︎
-
MINT: Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik.↩︎
-
T. Breda, C. Napp: “Girls’ comparative advantage in reading can largely explain the gender gap in math-intensive fields”, Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA 116, 2019, 15435–15440 , doi.org.↩︎
-
J. Money, J.G. Hampson, J.L. Hampson: “An examination of some basic sexual concepts: the evidence of human hermaphroditism”, Bull Johns Hopkins Hosp 97, 1955, 301-19.↩︎
-
J. Money, A. Ehrhardt : “Man & woman, boy & girl”, Baltimore (MD), John Hopkins University Press, 1972.↩︎
-
John Money und “Der Fall ‘John/Joan’”: de.wikipedia.org.↩︎
-
M. Diamond, H.K. Sigmundson: “Sex reassignment at birth. Long-term review and clinical implications”, Archives of Pediatrics and Adolescent Medicine, 151(3), 1997, 298–304, doi.org.
M. Diamond: “Sex, gender, and identity over the years: a changing perspective”, Child and Adolescent Psychiatric Clinics of North America 13(3), 2004, 591-607, doi.org, Volltext: hawaii.edu.
John Colapinto: “As Nature Made Him: The Boy Who Was Raised as a Girl”, Harper Perennial, 2006, 336 Seiten.↩︎ -
Jenny Graves: “Differences between men and women are more than the sum of their genes”, theconversation.com, archive.org.
A.P. Arnold: “Mouse models for evaluating sex chromosome effects that cause sex differences in non-gonadal tissues”. J Neuroendocrinol. 21(4), 2009, 377-386, doi.org.
J.B. Berletch et al: “Escape from X inactivation in mice and humans”, Genome Biology 11(6), 2010, 213, doi.org.↩︎ -
Deutscher Ärztinnenbund e.V.: “Geschlechtsspezifische Medizin”, aerztinnenbund.de, archive.org.↩︎
-
de.wikipedia.org: “Motte-and-Bailey-Argument”.↩︎
-
J.C. Zeller: “The German Dilemma Continues: Skepticism in the Face of Ideological Conflict”, 2024, skepticalinquirer.org.↩︎
-
Florian Aigner: “Die Schwerkraft ist kein Bauchgefühl: Eine Liebeserklärung an die Wissenschaft. Wie funktioniert wissenschaftliches Denken?”, Brandstätter Verlag, 2020, 256 Seiten.↩︎

 Deutsch (Deutschland)
Deutsch (Deutschland)  English (United Kingdom)
English (United Kingdom)